
Das Krankheitsbild der Wasserrute oder Schwanzlähmung ist auch unter den Bezeichnungen Kokzygeale Myopathie (griechisch: Schwanzmuskelleiden), limber tail syndrome (englisch: Syndrom der schlaffen Rute) oder cold water tail (englisch: Kalt-Wasser-Rute) bekannt.
Darunter versteht man eine vorübergehende schlaffe Lähmung der Rute des Hundes, meist in Verbindung mit einer Berührungsempfindlichkeit bzw. Schmerzhaftigkeit im Bereich des Rutenansatzes.
Junghunde und junge erwachsene Tiere sind etwas häufiger betroffen als ältere; Golden und Labrador Retriever, Setter, Pointer, Foxhound und Beagle erkranken statistisch betrachtet öfter als andere Rassen – dies ist vermutlich ihrer teils großen Affinität zu Wasser bzw. ihrem verstärkten jagdlichen Einsatz zuzuschreiben. Rüden sind etwas häufiger betroffen als Hündinnen.
Was tun bei einer Wasserrute oder Schwanzlähmung
Die Wasserrute oder Schwanzlähmung ist eine schmerzhafte Zustand, der vor allem Jagd- und Arbeitshunde betrifft, aber auch bei anderen Hunderassen auftreten kann. Sie äußert sich durch eine plötzliche Lähmung des Schwanzes, oft nach intensiver körperlicher Betätigung. Hier einige wichtige Schritte zur Behandlung und Prävention:
- Ruhe und Erholung: Schränken Sie die Aktivität Ihres Hundes ein, um den Schwanz zu entlasten. Vermeiden Sie körperliche Anstrengungen, die den Schwanz stark beanspruchen.
- Wärmebehandlung: Eine sanfte Wärmeanwendung kann helfen, die Schmerzen zu lindern und die Heilung zu fördern. Verwenden Sie dazu eine Wärmflasche oder ein warmes Handtuch.
- Medizinische Unterstützung: Konsultieren Sie unbedingt einen Tierarzt. Entzündungshemmende Medikamente können verschrieben werden, um Schmerzen und Schwellungen zu reduzieren.
- Sanfte Massagen: Vorsichtige Massagen können die Durchblutung fördern und Verspannungen lösen. Achten Sie darauf, dies sanft und nur nach Anleitung eines Tierarztes durchzuführen.

Krankheitsbild/Symptomatik einer Schwanzlähmung bei Hunden
Charakteristisch für das Krankheitsbild der Kokzygealen Myopathie ist das akute Auftreten der Symptomatik. Die Rute hängt dabei schlaff herunter, und im Bereich des Schwanzansatzes besteht eine vermehrte Berührungsempfindlichkeit bzw. Schmerzhaftigkeit, teils mit Absenkung der Kruppe.
Die betroffenen Tiere möchten sich oft nicht mehr hinsetzen oder nehmen den sogenannten Welpensitz ein, bei dem durch Abkippen des Beckens eine Entlastung der Rute und somit eine Schmerzvermeidung erzielt wird (engl. puppy-sitting). Manchmal ist das Fell im Bereich des Schwanzansatzes gesträubt; ein horizontales Wegstrecken der Schwanzbasis vom Körper weg wird häufig beobachtet.
Manche Hunde zeigen ein unsicheres Verhalten; sie wagen es nicht, Kot und Urin abzusetzen oder kratzen, beknabbern oder lecken sich vermehrt im Bereich des Rutenansatzes.
Über die exakte Ursache der Erkrankung herrscht nach wie vor Unsicherheit. Als wahrscheinlich gilt eine Durchblutungsstörung der Schwanzmuskulatur, die mit einem Untergang von Muskelfasern in diesem Bereich einhergeht.
Besonders häufig tritt die Symptomatik nach Schwimmen in kaltem Wasser, meist in Verbindung mit starker Strömung, auf. Man nimmt an, dass hier durch den Gebrauch der Rute als Steuer eine Überbelastung stattfindet.
Weitere prädisponierende Faktoren sind nasskaltes Wetter, ein schlechter Trainingszustand des Hundes und der Transport in zu kleinen Reiseboxen.
Die Symptome verschwinden in der Regel innerhalb weniger Tage bis zu zwei Wochen von selbst.

Diagnostik
Der Tierarzt kann die Diagnose meist mit hinreichender Sicherheit anhand der Symptomatik, in Verbindung mit dem Vorbericht (z. B. Hund war schwimmen im Fluss), stellen. Eine Blutuntersuchung sowie eine Elektromyografie (Messung der elektrischen Muskelaktivität) dienen der Diagnosesicherung.
Trotz des in der Regel harmlosen Verlaufs der Erkrankung empfiehlt sich ein Besuch in der Tierarztpraxis, um andere Krankheiten mit ähnlicher Symptomatik ausschließen zu können (u. a. Cauda-equina-Syndrom, Rückenmarkserkrankungen, Schwanzwirbelfrakturen, Erkrankungen im Bereich der Prostata und der Analbeutel).

Behandlungsmöglichkeiten einer Schwanzlähmung bei Hunden
Eine aufwändige Behandlung ist meist nicht notwendig, der Hund sollte aber einige Tage Schonung bekommen. Trockene Wärmeanwendung im Bereich der Schwanzbasis kann sinnvoll sein (z. B. Kirschkernkissen, Wärmelampe).
Bei einer ausgeprägten Schmerzhaftigkeit bekommt der Hund vom Tierarzt ein Schmerzmittel mit entzündungshemmender Komponente verordnet.
Nach einer mehrtägigen Schonung des Hundes kann mit einem leichten physiotherapeutischen Training begonnen werden.
In der Regel heilt die Erkrankung folgenlos aus.
Prophylaxe
Eine sichere Prophylaxe ist nur schwer möglich, dennoch gibt es einige Punkte, deren Beachtung zu einem selteneren Auftreten der Erkrankung beitragen kann:
- Es empfiehlt sich, den Hund nur in Gewässern ohne starke Strömung schwimmen zu lassen. Dauer und Intensität des Schwimmtrainings sollten seiner körperlichen Fitness angepasst sein; Überlastungen sollten vermieden werden. Hunde in optimalem Trainingszustand erkranken deutlich seltener.
- Transportboxen sollten so gewählt werden, dass der Hund sich gut darin bewegen kann. Auf Reisen sollte etwa alle zwei Stunden eine Pause mit Bewegungsmöglichkeit für den Hund eingelegt werden.
- Ein warmer, trockener und zugfreier Liegeplatz ist wichtig; insbesondere bei nasskalter Witterung trägt auch ein gründliches Trockenreiben des Hundes nach dem Spaziergang zur Prophylaxe der Erkrankung bei.

Prognose
Die Prognose der Wasserrute ist gut; ein erneutes Auftreten der Erkrankung (Rezidiv) ist möglich, kommt jedoch relativ selten vor. In seltenen Fällen bleiben leichte Lähmungserscheinungen bzw. eine abnorme Haltung der Rute zurück.
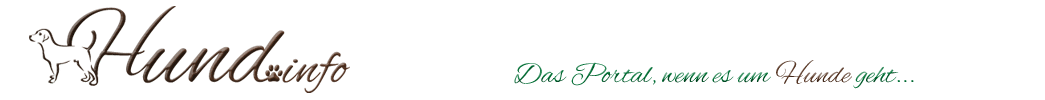
Diese Stellung Wedel zeigt Gizmo nun seit der Krebs-OP von Mitte April.
Nach zwei drei TA, ohne Erfolg, verwies er auf Physio.
Davon gab es dann 4 Einheiten, welche aber ebenso erfolglos blieben.
Darauf fragte ich mal wieder „Tierarzt Google“, der mir dann den Hinweis gab, dass es wohl eine Wasserrute wäre, die Gizmo plagt.
Also mit dem Veracht auf Wasserrute wieder zum Tierarzt.
Ich konnte ein Video und ein Foto machen.
Gizmos Ruten-Stellung bleibt im Liegen wie im Stehen gleich.
Tierarzt sah das etwas flüchtig an, stimmte zu, dass es Wasserrute wäre und verordnete 1x tgl. 40mg Onsior.
Leider gibt es seit dem, das war nun vor 5 Tagen, absolut keine Besserung.
Wir sind ratlos!